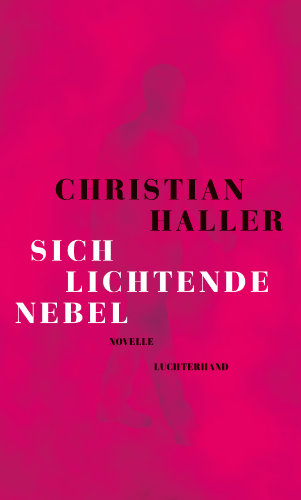| home | Aktuell | Lesungen | Biographie | Kontakt |
| Werke & Presse | Übersetzungen | Links | ||
| Presse-Bild | Audio & Video | login |
Vorschautext
Kopenhagen 1925: Ein Mann taucht im Lichtkegel einer Laterne auf, verschwindet wieder im Dunkel und erscheint erneut im Licht der nächsten Laterne. Wo ist er in der Zwischenzeit gewesen? Den Beobachter dieser Szene, Werner Heisenberg, führt sie zur Entwicklung einer Theorie, die im weiteren Verlauf ein völlig neues Weltbild schaffen wird: die Quantenmechanik. Der Mann im Dunkel selbst hingegen weiß nichts von der Rolle, die er bei der Entdeckung neuer physikalischer Gesetze gespielt hat – er versucht, den Verlust seiner Frau zu verarbeiten und seinem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Christian Haller, der diese beiden durch den Zufall verknüpften Lebenslinien weiter erzählt, macht daraus ein hellsichtiges literarisches Vexierspiel über Trauer und Einsamkeit, die Grenzen unserer Erkenntnis und die Frage, wie das Neue in unsere Welt kommt.
Literaturclub SRF, 7.3.23
„Das ist ein grossartiges Buch. Ein Meisterwerk.“
Usama Al Shahmani
Verleihung des Schweizer Buchpreises 2023.
Christian Haller, studierter Naturwissenschaftler und Autor, nähert sich in seinem Buch Fragen, die für die Literatur wie für die Wissenschaft relevant sind: wie beschreibt man Unbeschreibliches? Wie sagt man Unsagbares? Wie verlässlich ist unsere Wahrnehmung? Meisterhaft verdichtet er die komplexen Themen zu einer Novelle, die einfach und leicht verständlich daherkommt und dabei durch gedanklichen Tiefgang ebenso überzeugt wie durch sprachliche Eleganz und Klarheit.
Begründung der Jury
Hier wiedergegeben die Laudatio von Michael Luisier, SRF Literaturredaktor und seit diesem Jahr Mitglied der Jury des Schweizer Buchpreises:
Die Geschichte ist bekannt. Ein Mann geht durch Nacht und Nebel. Betritt einen Lichtkreis, verlässt ihn wieder und taucht im nächsten Lichtkreis wieder auf. Ein anderer Mann beobachtet ihn dabei. Und weil der sich gerade mit physikalischen Fragen auseinandersetzt, mit Atommodellen und der Beschaffenheit des Lichts, kommt ihm der Gedanke, respektive die entscheidende Frage in den Sinn: Woher weiss man, dass ein Mensch, der soeben einen Lichtkreis verlassen hat und weitergeht, im nächsten Lichtkreis wieder auftaucht? Und nicht einfach verschwindet?
Diese Anekdote erzählt die Geschichte hinter der Entdeckung der Quantenmechanik durch den Physiker Werner Heisenberg. Sie ist der Ausgangspunkt einer Novelle, die sehr bald zu einer ähnlich dringenden Frage führt, nämlich: Wie geht man generell mit Dingen um, die stattfinden, obwohl sie eigentlich nicht stattfinden sollten? Und – hier kommt die Literatur ins Spiel – wie beschreibt man die?
Wie sagt man Unsagbares? Wie beschreibt man – literarisch – nicht zu Beschreibendes? Das sind die zentralen Fragen des Texts.
Christian Haller, Schriftsteller und selbst Naturwissenschaftler, hat sich dieser literarischsten aller Aufgabe gestellt. Haller hat sich als Literat für die Novelle als Erzählform entschieden, weil es sich dabei grundsätzlich um die Vermittlung einer «sich ereigneten unerhörten Begebenheit» handelt, wie es bei Goethe heisst.
Der Naturwissenschaftler, der sehr wohl weiss, dass die Naturwissenschaft nicht alles erklären kann, hat sich für ein nicht materielles Phänomen in einer materiellen Welt entschieden. Im Text ist von «Durchbrüchen» die Rede, erlebt durch die zweite Figur dieses Textes, den Beobachteten, dessen Weg genauso beschrieben wird wie der des Beobachters. An diesem zeigt Christian Haller diese «Durchbrüche», die man auch spirituell deuten kann, als Ausdruck von Rausch, als Zustände welcher Art auch immer. Oder vielleicht auch ganz anders, wer weiss. Es selbst sagt es nicht.
Meisterhaft ist es Christian Haller gelungen, sich dabei aufs Wesentliche zu beschränken: Zwei miteinander verschränkte Geschichten im Wechsel erzählt, wobei nicht ein Wort zu viel ist, nicht ein Moment aus blossem Zufall entstanden scheint. Alles ist so einfach, schön und klar geschaffen, als könnte man Unsagbares tatsächlich nur auf diese Weise sagen.
Ja. Die Novelle «Sich lichtende Nebel» von Christian Haller ist Klarheit, Schönheit und im besten Sinne auch Einfachheit. Drei Argumente für eine Verleihung des Schweizer Buchpreis 2023. Christian Haller, wir gratulieren Ihnen dazu.
|
NZZ am Sonntag, Bücher am Sonntag
Christian Hallers Novelle «Sich lichtende Nebel» erzählt von zwei Männern und von der Entdeckung der Quantenmechanik. Dem achtzigjährigen, vor allem für seine autofiktionalen Romane bekannten Erzähler ist ein Stück funkelnder Prosa gelungen. Von Manfred Papst Kopenhagen im Jahr 1925, abends spät. Ein junger Mann beobachtet, wie ein anderer Passant seines Weges geht. Kurz erscheint er im Licht einer Strassenlaterne, dann verschluckt ihn die Dunkelheit wieder, bis er im nächsten Lichtkegel erneut auftaucht. Gibt es Gewissheit darüber, dass der Beobachter beide Male den gleichen Mann gesehen hat? Wäre das eine objektive Tatsache, oder stellt er den Zusammenhang nur im Kopf her? Wüsste er etwas von der Existenz des anderen, wenn er immer nur dann in dessen Richtung geblickt hätte, als er sich im Dunkel zwischen den Lichtkegeln bewegte? Diese kleine Szene ist der Ausgangspunkt von Christian Hallers Novelle «Sich lichtende Nebel». Der Aargauer Autor, der auf ein weitverzweigtes Werk rund um zwei biografisch grundierte Romantrilogien zurückblickt, hat den funkelnden Text sich und seiner Leserschaft zu seinem achtzigsten Geburtstag geschenkt, zusammen mit dem eng mit ihm verwandten Essay «Blitzgewitter», von dem hier ebenfalls kurz die Rede sein soll. Noch aber sind wir im nächtlichen Kopenhagen. Der Mann, der da durch die Strassen geht, ist Professor für Geschichte, emeritiert, verwitwet; sein Name: Helstedt. Er ist keine historische Figur, ganz im Gegensatz zu seinem Beobachter: Bei diesem handelt es sich nämlich, auch wenn der Name nicht genannt wird, um den jungen Physiker Werner Heisenberg, einen Mann von 24 Jahren, der sich gerade in Göttingen habilitiert hat. Jetzt besucht er seinen 16 Jahre älteren, bereits weltberühmten dänischen Kollegen Niels Bohr, der ein bahnbrechendes Atommodell entwickelt hat und drei Jahre zuvor mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Die Gespräche mit ihm sind lebhaft und ergiebig – wenn nur dieser scheussliche Heuschnupfen Helstedt nicht ausser Gefecht setzen würde! Was kann da noch helfen? Vielleicht Meeresluft? In die Materie hineinblicken Heisenberg sucht – das ist historisch verbürgt – Linderung auf der nahen Nordseeinsel Helgoland, die von Cuxhaven aus leicht zu erreichen ist und auf der es aufgrund der kargen Vegetation kaum Pollenflug gibt. Dort hat er Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen. In ihnen verbinden sich die Gespräche mit Bohr und die nächtliche Szene in Kopenhagen zu Bildern, aus denen er seine revolutionären Ideen zur Quantenmechanik entwickeln wird. Die Nebel lichten sich, wie es der Titel der Novelle verspricht, doch was sie freigeben, ist ausgerechnet die Unschärferelation. Was für ein Einfall! Er ist so bezeichnend für den Erzähler Christian Haller wie der Umstand, dass er Heisenbergs Gegenfigur Helstedt nicht etwa aus der Novelle verabschiedet, nachdem sie im Licht der Laterne ihre Schuldigkeit getan hat, sondern auch ihrer Spur folgt. In je achtzehn kurzen, einander abwechselnden Kapiteln stellt er die Schicksale der ungleichen Männer einander gegenüber. Während Heisenberg unterwegs zu einer epochalen Entdeckung ist, scheint Helstedt sich in merkwürdigen Träumereien zu verlieren. Er glaubt, über ein erweitertes Bewusstsein zu verfügen und gleichsam in die Materie hineinblicken zu können, so dass er deren Kräfte von Anziehung und Abstossung im Mikrobereich sinnlich wahrnehmen kann. Er sieht Tisch, Boden, Wände, aber auch die Äste und Blätter als vollständig durchsichtig, als «eine Art Glutfunken», als «bewegte Zustände von Energie, von unglaublicher, leuchtender Schönheit», und er selbst wird zum Teil dieses Geschehens. Doch wie soll er eine Sprache für das finden, was er da erlebt? Das bringt ihn in Not, zumal er hinnehmen muss, dass sein nüchterner Freund Sörensen ihn nicht ernst nimmt und seine Augenärztin meint, er leide bloss an Halluzinationen. Für uns als Leser aber ist es ungemein faszinierend, Heisenbergs und Helsteds gewissermassen komplementären Denkwegen zu folgen. Beide setzen sich auf ihre Weise mit einer Welt auseinander, die sich der Klassifizierung und Vermessung entzieht. Aus der klar umrissenen Materie werden volatile energetische Zustände kleinster Teilchen. Und beide Protagonisten merken, dass sie keine unbeteiligten Beobachter sein können, sondern durch ihr Vorhandensein das Beobachtete verändern. Übrigens geht beiden auch eine Frau im Kopf herum: Bei Heisenberg ist es seine Zimmerwirtin auf der Insel, bei Helstedt ist es Linn, eine alleinstehende Frau aus der Nachbarschaft, an die er fortan seine Aufzeichnungen adressiert. Es ist alles andere als leicht, die Quantenmechanik und die Unschärferelation in einfachen Worten zu erklären. Christian Haller aber löst die Aufgabe meisterhaft. Wir folgen seiner Geschichte so gebannt, dass wir gar nicht merken, welch komplexe Gedanken sie in ihrer klaren, sinnlichen Sprache entfaltet. Der Text leuchtet von innen her; in der Manier klassischer Novellen ruht er dabei gelassen in sich. Das ist etwas Neues bei diesem Autor, für den – wie für einen Bildhauer – der Widerstand des sprachlichen Materials immer wichtig war. Leichtfertig, gefällig, tänzerisch hat Christian Haller nie geschrieben; auch seine grandiose «Trilogie des Erinnerns», die aus den Bänden «Die verschluckte Musik», «Das schwarze Eisen» und «Die besseren Zeiten» besteht, ist gemeisselt, nicht al fresco gemalt. Das grosse Ganze denken Wer sich mit Hallers Novelle «Sich lichtende Nebel» beschäftigt, liest mit Gewinn auch seinen fast gleichzeitig erschienenen Essay «Blitzgewitter». In ihm schreibt der Autor eine «kurze Geschichte des Lichts, in das wir uns stellen» (so der Untertitel), und geht der Frage nach, wie sich unsere Lebenswelt durch die Digitalisierung verändert hat. Er zeichnet die Entwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses von Licht und Bildproduktion nach und beleuchtet die physikalischen Aspekte der Frage ebenso wie die philosophischen, soziologischen und politischen. Dabei geht er zurück bis ins Mittelalter; er skizziert die Wandlung vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild, zeigt, wie das sich seiner selbst bewusst werdende Subjekt in der Renaissance auf den Plan tritt und wie die Aufklärung sowie die modernen Naturwissenschaften, allen voran die Physik, die Wahrnehmung und die Deutung der Welt verändert haben. Dabei weist er auch hier der Quantenmechanik Heisenbergs eine Schlüsselrolle zu. Mit dem Mut zur Verkürzung und zur scharfen Konturierung erweist sich Haller, der in jungen Jahren an der Universität Basel Zoologie studiert hat, als origineller, kantiger Kopf, der das Denken weder delegiert noch in ein Referenzsystem von fachspezifischen Autoritäten einpasst, sondern das grosse Ganze als Einzelner nochmals von Grund auf zu denken versucht. Das mag man als unzeitgemäss empfinden; es ist indes originell und gelungen. Der klar aufgebaute Text mit seinen 133 kurzen Paragraphen ist zudem auch von literarischem Reiz. Beiden Büchern, der Novelle und dem Essay, ist gemeinsam, dass sie die «Ordnung der Dinge» mit der fragilen Schönheit der gefährdeten und vergänglichen Welt in eins denken. Im Schauen liegt für den alten Helstedt am Ende das Glück: Mit versonnenem Lächeln nimmt er einen Schluck aus der Kaffeetasse. |
WOZ, 1. 6. 2023
Im Strom der Funken
Eben achtzig Jahre alt geworden, hat sich der Schweizer Schriftsteller Christian Haller gleich doppelt beschenkt: mit einer meisterliche Novelle und einem erhellende Essay zu Fragen moderner Physik.
Von Hans Ulrich Probst
An einem späten Abend beobachtet ein junger Mann im Kopenhagen des Jahres 1925, wie ein anderer Fußgänger im Licht einer Straßenlaterne erscheint und nach wenigen Schritten im Dunkel verschwindet, ehe er im nächsten Lichtkreis erneut auftaucht. Gewissheit darüber, ob der Unbekannte erneut im Licht erscheinen wird, gibt es keine, und hätte er stets gerade dann hingeblickt, wenn sich der andere im Dunkel zwischen den Lichtkreisen befand, dann wäre der Beobachtete für den Beobachter inexistent geblieben. Von diesem Phänomen aus entwickelt der Autor und ausgebildete Naturwissenschaftler Christian Haller seine Novelle „Sich lichtende Nebel“, eine philosophische Erzählung zur Entwicklung der Quantenphysik durch den Physiker Werner Heisenberg.
Um diesen handelt es sich nämlich bei dem nächtlichen Beobachter, auch wenn er im Buch nie beim Namen genannt wird. Der 24-jährige Heisenberg weilt für Forschungsdebatten beim schon berühmten Atomphysiker Niels Bohr. Wegen hartnäckigen Heuschnupfens zieht er sich – so wird es überliefert – erschöpft auf die Insel Helgoland zurück und schafft dort den theoretischen Durchbruch zur so genannten Quantenmechanik. Diese revolutioniert die damalige Physik: Sie bringt den Abschied von klar umrissen und Definitionen von Materie und beschreibt zugleich das verschwinden und das wieder auftauchen der kleinsten Teilchen neu als energetische Zustände.
Diesen auch für praktische Anwendungen bis hin zur Digitaltechnik epochale Forschungsfortschritt setzt Haller knapp und gekonnt in Szene. Freilich gilt sein Interesse ebenso sehr dem Gegenpol des Physikers: jenem im Lichtschein beobachteten Unbekannten, dem der Autor ein fiktives Leben und einen Namen gibt und der im Wechsel mit Heisenberg in je achtzehn Kapiteln zur Sprache kommt.
Pfeil der Erkenntnis
Helmstedt, wie ihn Haller nennt, ahnt nichts von Heisenberg Erkenntnispfeil. Er ist pensionierter Historiker, seit kurzem verwitwet und vom Vereinsamung bedroht. An jenem Abend hat er sich, nicht zum ersten Mal, mit seinem Freund, einem positivistischen Rationallisten, über Wahrheit und Wirklichkeit gestritten. Dann erlebt er mehrfach halluzinatorische Visionen, wobei er „Tisch, Boden, Wände, aber auch die Äste und Blätter“ als „vollständig durchsichtig“ wahrnimmt, als „eine Art Glutfunken“, als „bewegte Zustände von Energie, von unglaublicher, leuchtender Schönheit“. Sich selbst erfährt er dabei als „Teil in dem Geschehen“, im „Strom von Funkengebilden“, die „in einem dauernden Austausch standen“.
Verunsichert und euphorisiert zugleich, fragt er eine Augenärztin: „Wie kann man erklären, dass man etwas sieht, was man eigentlich nicht sehen kann?“ Doch die Frau winkt ab: „Das ist nicht möglich. Sie können zwar das Gefühl haben, in einen Gegenstand hineinzusehen, doch dabei wirken aus Wissen angeregte Vorstellungen. Diese werden quasi durch ihren Blick mitgesehen, so dass sie glauben, etwas zu sehen, was aber Einbildung, Imagination ist“.
Wie Heisenberg für die Teilchenphysik akzeptieren muss, dass manches nicht erklärbar bleibt und das als gesichert nur gelten kann, was beobachtet werden kann, so überlässt sich Helmstedt der Wahrheit seine Erlebnisse mit der Welt. Diese offenbart sich ihm als „Meer aus Glutteilchen“, mit denen er selbst „in dauernder Wechselwirkung“ steht. Obwohl er nichts davon beweisen oder erklären kann, zieht der alte Historica aus der Wahrheit seiner (ästhetischen?, mystischen?) Erfahrung am Ende vielleicht sogar Trost – zumindest aber die Gewissheit, „in einem äußerst eingeschränkten Wahrnehmungsraum zu leben“.
Wie der Blitz
Die kapitale Herausforderung, das Nicht-zu-Sehende und Nicht-Sagbar in Worte zu kleiden, meistert Haller mit Bravour. In seiner wunderbar einfachen, leuchtenden Sprache geleitet er die Lesenden mit Leichtigkeit und schierer Schönheit durch den schmalen Text. Diese ästhetische Erfahrung macht das Verständnis dessen, was schwer oder gar nicht zu verstehen ist, vielleicht eher möglich als alle rechnerische Beweisführung ( die auch Heisenberg nicht restlos gelingen sollte). „Sich lichtende Nebel“ ist ein großartiges Stück Literatur und wohl Hallers stärkstes Buch seit seinem Roman „Die verschluckte Musik“ (2001).
Quasi komplementär zu dieser klar fokussierten und hochpoetischen Novelle ist der Essay, den Christian Haller zuvor unter dem Titel „Blitzgewitter“ vorgelegt hatte. In dieser „kurzen Geschichte des Lichts, in das wir uns stellen“, überfliegt der Autor im Eiltempo die Jahrhunderte: In sechs Kapiteln und 133 Absätzen beschreibt, erörtert, interpretiert er die Entwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses von Licht und Bildproduktion – physikalisch, philosophisch, soziologisch, politisch. Blitzgewitter ist ein wahrlich wagemutiger Versuch auf kaum hundert Seiten, bleibt aber trotz hoher Komplexität und unvermeidlicher Verkürzungen bestens lesbar, denn auch für dieses Vorhaben findet Haller eine geschmeidige, glasklare Sprache. Zwei grundverschiedene Bücher, die doch vielfach korrespondieren – gleichermaßen herausragend.
NZZ, 28. 02. 2023
Philosoph der Unsicherheit
Das Ungewisse lockt ihn: Der Autor Christian Haller wird 80
Paul Jand
Literatur ist manchmal paradox. In allergrösster Präzision beschreibt sie das Ungefähre. In Christian Hallers neuester Novelle, «Sich lichtende Nebel», geht ein Mann durch das nächtliche Kopenhagen. Er verschwindet im Dunkel, wenn er den Lichtkegel einer Strassenlaterne verlässt. Gehend taucht er im Schein der nächsten Lampe auf, bis er wieder unsichtbar wird. Was ist im Dazwischen? Was genau sehen wir, und warum glauben wir an eine Wirklichkeit, deren Zusammenhänge sich erst in unserem Kopf herstellen?
Christian Hallers Geschichte treibt ein philosophisches Spiel, in dem vieles nicht ist, was es scheint. Tatsachen und Einbildungen überlagern einander. Kaum mehr als 120 Seiten braucht die Novelle, um einen grossen Bogen vom nächtlichen Kopenhagen der zwanziger Jahre bis zur Quantenphysik zu schlagen.
Der Mann, der da durch die Strassen geht, ist ein gewisser Herr Helstedt, pensionierter und verwitweter Geschichtsprofessor. Sein Beobachter ist ungleich berühmter und jedenfalls auch ausserliterarisch verbürgt: der Physiker Werner Heisenberg. 1925 besucht der junge Heisenberg den dänischen Kollegen Niels Bohr. Man debattiert, man versteht sich, aber da kündigt sich gerade ein schlimmer Heuschnupfen an. Der Rest ist tatsächlich Geschichte: Heisenberg lindert seine Allergien in der Meeresluft der Insel Helgoland. Weil er genügend Zeit hat und die Gedanken zu schweben beginnen, gelingt es ihm, seine revolutionären Erkenntnisse zur Quantenmechanik zu formulieren.
An den offenen Enden
Christian Hallers Novellen-Titel «Sich lichtende Nebel» ist meteorologischer Befund und Metapher zugleich: Auf Helgoland reisst der Himmel auf. Für die Physik öffnet sich der Blick bis tief in die Sphäre des Atomaren. Die physikalische Moderne des 20. Jahrhunderts beginnt.
Wenn der heute achtzigjährige Christian Haller als Autor immer noch nicht ausreichend gewürdigt ist, dann liegt das vielleicht an einer schreiberischen Konstitution. In seinem Werk fehlt der Gestus der Selbstgewissheit. Seine Bücher sind keine Behauptungsliteratur, sondern sie widmen sich der Wirklichkeit in einem Näherungsverfahren. Hallers grosse literarische Selbsterforschungen wie die «Trilogie des Erinnerns», der Roman «Im Park» oder die späteren, an der Aare spielenden autobiografischen Romane handeln von Ambivalenzen, von den offenen Enden der Realitätserfahrungen.
«Sich lichtende Nebel» bringt diese Poetologie des Autors noch einmal auf den Punkt: Aus dem Nebel des Nichtwissens führt die Physik als Wissenschaft heraus, aber was ist der atomare Kern des Menschen selbst? Während Werner Heisenberg etwas findet, beginnt sich Hallers Gegenfigur Helstedt immer mehr zu verlieren. Im Gespräch mit seinem rationalistischen Freund Sörensen versucht er plötzliche sonderbare Wahrnehmungen zu enträtseln, erntet aber nur Spott.
Geistig-seelisches Drama
Helstedt hat das Gefühl, in die Materie um sich herum hineinschauen zu können. Er sieht die Kräfte gegenseitiger Anziehung und Abstossung. In den Dingen erkennt er «bewegte Zustände». Sein Blick ist plötzlich wie der eines Physikers, der selbst zum Instrument seiner Wissenschaft geworden ist. In dieser erschöpfenden Erfahrung gerät alles ins Wanken. Der alte Geschichtsprofessor versucht eine Sprache für das Gesehene zu finden, aber wo für Heisenberg die Unschärfe zum Kern der Entdeckung wird, weiss der Geschichtsprofessor nicht weiter.
Es ist ein geistig-seelisches Drama, das Christian Haller ins milde Licht des Mitgefühls taucht. Der Schweizer Schriftsteller bleibt auch mit seinem neuen Buch der Philosoph einer existenziellen Unsicherheit: Statt Klarheit über sich und die Welt zu erlangen, wandelt der Mensch in Nebelkammern. In seinem inneren Helgoland bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf Sicht zu gehen.
NZZ am Sonntag, 26. 3. 2023
Christian Haller schreibt in seinem makellosen Text nicht Spielfiguten, sondern lebendige Menschen, die uns in ihrer Einsamkeit und Lebenssehnsucht sehr nache kommen.
Manfred Papst,
Aargauer Zeitung, Donnerstag, 17. 2. 23
Die Sinne, der Verstand und das Licht
Christian Hallers Novelle «Sich lichtende Nebel» oder Die vermeintliche Klarheit der Unschärferelation
Markus Bundi
Warum lassen sich der Radrennfahrer auf seiner halsbrecherischen Abfahrt und der Hintergrund der alpinen Landschaft nicht zugleich, sprich auf einem Bild, scharf ablichten? – So oder so ähnlich lautet die Einstiegsfrage des Physiklehrers, wenn er seine Klasse auf Heisenbergs «Unschärfe-Relation» einstimmen will. So unsexy Physikunterricht auch immer sein mag, ohne die Formeln, auf die zum Beispiel Albert Einstein (1879–1955) oder Werner Heisenberg (1901–1976) gekommen sind, gäbe es die Technologie von heute nicht.
Die mathematischen Gleichungen, die Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die uns den Zugang zum Mikrokosmos (und darüber hinaus) ermöglichen, das sind mit Sinnlichkeit aufgeladene Quantensprünge. Das weiss einer, der sich in jungen Jahren den Naturwissenschaften verschrieben hatte, im Grunde seines Herzens aber schon immer Schriftsteller war: Christian Haller (*1943), der Zoologie in Basel studierte, dessen literarisches Œuvre mittlerweile auf zehn Romane, mehrere Gedichtbände, Dramen und Essays angewachsen ist, entführt seine Leserinnen und Leser diesmal – auf Helgoland.
Das ist diese kleine Insel, die ziemlich verlassen in der Nordsee steht, zu erreichen mit der Fähre von Cuxhaven aus. Gut erschlossen, mittlerweile, für den Tourismus offen, gut gelegen schon vor hundert Jahren für Allergiker, da sich der Pollenflug aufgrund der kargen Vegetation arg in Grenzen hält. Und das ist auch einer der Gründe, warum sich der Protagonist in Hallers Novelle «Sich lichtende Nebel» im Jahr 1925 zu einer Überfahrt entschliesst.
Der junge Mann, Gast am Kopenhagener Physikinstitut, leidet indes nicht nur an Heuschnupfen, sondern auch an Berechnungen zu den Umlaufbahnen von Elektronen. Es ist höchste Zeit, den Kopf wieder freizukriegen, zumal ihn eine nächtliche Beobachtung seinerseits aus der Bahn geworfen hat. Selbstvergessen sass er auf einer Bank hinter dem Institut und sah, wie ein Mann im Lichtkreis einer Strassenlaterne erschien, verschwand und wenig später unter der nächsten Laterne wieder auftauchte. Wo war der Gehende in der Zwischenzeit? Über den Aufenthaltsort des andern im Dunkeln gibt es keine Gewissheit.
Dass es sich beim «Beobachter», so wird der junge Physiker genannt, um die historische Figur Werner Heisenbergs handelt, wird von Haller bereits im Motto zur Novelle angezeigt: «Beim Aufstieg hatte sich der Nebel immer dichter um unseren enger werdenden Pfad geschlossen ...». Der angefangene Satz stammt tatsächlich von Heisenberg und rekurriert auf eine Wanderung mit seinem dänischenMentor – hinter dem sich also kein geringer als Niels Bohr verbirgt, der 1922 den Nobelpreis für Physik erhielt.
Und der Beobachtete? – Fraglos ein Statist, der in den Augen Heisenbergs zufällig zum corpus delicti wird. Könnte man meinen. Im Gegensatz zum Physiker lässt der Schriftsteller den älteren Mann nicht aus dem Blick, kürt ihn stattdessen zur zweiten Hauptfigur. Der von Laternen Beleuchtete, das ist Helstedt, emeritierter Geschichtsprofessor, der nachts auf seinem Nachhauseweg war. Seiner akademischen Pflichten entledigt und Wittwer, ernährt sich Helstedt mehr schlecht als recht, liest nur noch wenig, hält sich an einen missliebigen alten Freund, beschränkt sich ansonsten aufs Schauen und Schlafen: «Nein, er wusste nicht, wo er war und hatte auch kein Ziel. Ausser vielleicht zu schauen. Was immer er ansah, bekam einen kristallenen Glanz und war von einer leuchtenden Schönheit.» Und was der hellsichtige Historiker da träumte, wird alsbald Wirklichkeit sein.
Während Helstedt darüber nachdenkt, «dass Träume in einer seltsamen Asymmetrie zum Alltagsleben» stehen, erholt sich Heisenberg auf Helgoland und beobachtet, wie der Nebel «in langen Bänken vom Meer gegen die Insel» treibt. Mit anderen Worten: Hallers Novelle ist als virtuose Tandem-Geschichte angelegt; im Leben beider lichtet sich allmählich der Nebel. Die jeweiligen Erkenntnisse gehen dabei weit übers Palindrom hinaus. Heisenberg macht die Bekanntschaft mit seiner Gastgeberin auf Helgoland, Helstedt verguckt sich in Linn, die ihm als Adressatin für seine Aufzeichnungen dient: «... was ich sah, waren blau strahlende Energiezustände – wobei das Wort ‹Zustände› falsch ist. Diese ‹Energiezustände› waren nicht statisch, wie die Wortbedeutung nahelegt, sondern in beständiger Bewegung, allerdings je nach Gegenstand oder Material langsamer oder schneller, kaum wahrnehmbar in den Wänden, gut sichtbar in den Gardinen, schnell in den Ästen und Blättern.»
Die Sinne von Helstedt und der Verstand Heisenbergs führen zu Überblendungen, die sich einer exakt zu berechnenden Welt entgegensetzen. Die Unschärfe, die der Physiker letztlich in eine mathematische Matrix giesst, lässt den Historiker die Grenze zwischen Leben und Tod überwinden. Wahrlich unerhörte Ereignisse, wie sie schon nach Goethes Dafürhalten eine Novelle auszeichneten! Und was die Wechselwirkung zwischen Wahrscheinlichkeit und Wahrhaftigkeit betrifft, da ist Christian Haller mit «Sich lichtende Nebel» ein kleines Meisterwerk geglückt.
Klosterzeitung Salve, März 2023
Bruder Gerold Zenoni
Christian Haller gestaltet mit den Schauplätzen Kopenhagen und Helgoland souverän einen literarischen Parforceritt zu den Grenzen menschlicher Erkenntnis, mal statisch geerdet dann wieder luzid in Spähren geahnter Möglichkeiten.
FAZ, 28.2.2023
Im Bergwerk der Sprache
Christian Haller zum Achtzigsten
Kurt Drawert
Seit Annie Ernaux den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, ist autofiktionale Prosa fast etwas Mode geworden. Vor allem im deutschen Sprachraum drängen Bücher auf den Markt, deren Erzählfigur vorgibt, mit dem Verfasser identisch zu sein. Das mag einem Verlangen nach Authentizität zu entsprechen, zumal vor dem Hintergrund sich aufdrängender Simulationsrealitäten, die unser Leben immer radikaler beherrschen. Dabei ist das Motiv, das eigene Selbst zu einem Objekt der Reflexion werden zu lassen und die subjektive Erfahrungsgeschichte zu einem Erzählgegenstand, so alt wie die Literatur seit Augustinus von Hippo. Es überrascht also, wenn es bisweilen noch überrascht; denn wer könnte geeigneter sein, exemplarisch auf die Geschichte der Welt zu verweisen und im Mikrokosmos der familiaren Herkunft auf das Wesen einer Epoche, wenn nicht das sich seiner selbst bewusste Subjekt? Das immer wieder literarisch zu thematisieren und gegen oft heftige Widerstände durchzusetzen, ist der Werdegang des Schweizer Schriftstellers Christian Haller. Geboren 1943 in Brugg, Kanton Aargau, studierte er Zoologie in Basel, arbeitete als Bereichsleiter der „Sozialen Studien“ am Gottlieb Duttweiler Institut und als Dramaturg eines Theaters in Baden, ehe er sich als Schriftsteller selbstständig machte. Seitdem gibt es fast zwei Dutzend Bücher von ihm, die von ihrer Intention und innersten Notwendigkeit her obsessiv um ein und dieselbe Frage kreisen: Wer ist „ich“, wenn ein Ich „ich“ gesagt hat. Oder einfacher: Was können wir über uns wissen und sagen. Diese Positionsbestimmung in cartesianischer Tradition und eingebunden in die Geschichte der Zeit ist die vielleicht entscheidende für unsere digitale Moderne, in der sich das Subjekt selbst aus dem Weg räumt: Wer sind wir, wer waren wir, wer werden wir sein. Haller fragt genau das immer wieder, erfindet Reflektorfiguren, die „ich“ für ihn sagen wie im dritten Band seiner autobiografischen Prosa, in dem ein Freund es dem Erzähler, der es selbst nicht hervorbringen kann, abnimmt: „Den Boden, den wir nicht gehabt haben, schaffen wir uns selber. Mit Buchstaben und Wörtern, die wir zu Geschichten verfugen, geben wir dem Ich einen Grund, machen das Nichts begehbar und steigen an Orte, wo kein Boden mehr nötig ist.“ Diese literarische Begründungsarbeit ist vor allem mit der Trilogie „Die verborgenen Ufer“ (2015), „Das unaufhaltsame Fließen“ (2017) und „Flussabwärts gegen den Strom“ (2020), aus dem das Zitat stammt, grandios geleistet. Sie steht in einer Tradition zu Entwicklungsromanen wie dem „Anton Reiser“ von Karl Philipp Moritz oder dem „Porträt des Künstlers als junger Mann“ von James Joyce. Nur dass Christian Haller lange warten musste, ehe ihm Anerkennung zuteil geworden ist – unter anderem mit dem Aargauer Literaturpreis 2006, dem Preis der Schillerstiftung 2007 sowie dem Aargauer Kunstpreis 2015. Vorher sah es eher so aus: „Nach zwei, drei Seiten unterbrach mich ein Zwischenruf, ein Zuhörer war im Publikum aufgestanden, rief in den Saal, er protestiere, das sei keine Literatur, die ich da vortrage, das seien Klischees und banale Sätze.“ Und als wäre das nicht schon genug, erhebt sich auch noch ein Mitglied der Programmkommission und entschuldigt sich dafür, ihn eingeladen zu haben. Wer danach noch weiterschreibt, ist, was wir einen Schriftsteller nennen –unermüdlich im Bergwerk der Sprache. Wenn Christian Haller heute seinen achtzigsten Geburtstag begeht, dann liegen auch zwei neue Bücher von ihm vor: „Sich lichtende Nebel. Novelle“, sowie der Essay: „Blitzgewitter. Eine kurze Geschichte des Lichts, in das wir uns stellen.“ Glückwunsch.
Infosperber, 27. 4. 2023
Physik und Phantasie
Christian Haller befasst sich in einer Novelle und in einem Essay mit den Folgen der modernen Physik.
Felix Schneider
«Blitzgewitter» heisst Hallers Essay (erschienen bei Matthes & Seitz, Berlin 2023). «Blitzgewitter» erlebe ich heutzutage vorwiegend in der Pariser Métro. So vielfältig dort die Fahrgäste erscheinen – divers hinsichtlich Hautfarbe, Herkommen, Klasse, Alter, Geschlecht, Outfit – fast alle konzentrieren sich, oft mit Stöpseln in den Ohren, auf ihre Handys. Und wenn ich auf einen ihrer kleinen Bildschirme schiele, wird mir schwindlig ob des Tempos, in dem dort ein Finger sekundenschnell neue Bilder zum Aufblitzen bringt.
Was Realität ist, bestimme ich
In Hallers Essay entdecke ich zu meiner Verblüffung, dass die Erfindung der Perspektive in der Malerei der Renaissance verstanden werden kann als allerersten Schritt auf dem langen Weg in die Virtualität von heute, denn die Perspektive ist die erste, gezielte Täuschung des Sehens. Hallers «Geschichte des Lichts, in das wir uns stellen», so der Untertitel des Essays, kann man lesen als eine Geschichte der optischen Wahrnehmung und der Bildproduktion. Enthüllt wird dabei der zunehmende subjektive Anteil des Beobachters bei der Herstellung sowohl von inneren Bildern im Gehirn als auch von äusseren auf Leinwand, Papier oder Bildschirmen. Am Beginn der Neuzeit steht die Auffassung, die Welt sei ebenso objektiv gegeben wie ihr Abbild in der Camera obscura, das unbeeinflusst vom Betrachter nur vom Licht selbst erzeugt sei. Verunsicherung schafften dann später die Nachbilder auf der Netzhaut. Sie waren offensichtlich vom Betrachter erzeugt. Und Goethe fand die Formulierung: «Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken». Im 19. Jahrhundert wird klar, dass unsere Nerven nicht blosse Leiter sind. Angeregt von äusseren Impulsen bringen sie vielmehr ihren eigenen Zustand ins Bewusstsein. «Wir empfinden nicht das Messer, das uns Schmerz verursacht, sondern der Zustand unserer Nerven ist schmerzhaft.» (Johannes Müller, Physiologe). Und heute? Das digitale Bild ist streng genommen kein Abbild mehr, es ist eine Lichtrechnung. Deswegen kann ich mit dem Handy im Dunkeln fotografieren, kann Belichtung, Farben und Formen ändern, Störendes entfernen, und alles wieder in das ursprüngliche Bild zurückrechnen. Ich erinnere mich an den Lehrer in der Londoner Volkshochschule, der das Bildbearbeitungstool «Photoshop» erklärte und uns zur Übung ein Foto der Themse bearbeiten liess. Wir lernten Schiffe entfernen, dazusetzen, verändern. Auf meine Frage, was mit der Realität sei, antwortet er: Das bestimmen Sie.
Ein tollkühnes Unternehmen
Die hier herausgelesene Entwicklung der Bildproduktion ist bei Haller eingebettet in eine Geschichte der europäischen Weltbilder und Gesellschaftsformationen von der Renaissance über den Absolutismus und das bürgerliche Zeitalter bis in die Gegenwart. Ihn interessiert, wie die Wissenschaften, insbesondere die Physik, die menschlichen Vorstellungen von Natur und Gesellschaft ebenso wie die wirkliche soziale Organisation der Menschen beeinflussen. Das ist ein geradezu tollkühnes Unternehmen. Auf gerade mal hundert kleinen Seiten stürmt Haller durch 600 Jahre europäischer Geschichte. Seine Methode: viel lesen, viel denken – und wenig schreiben. Seine Sprache: knapp, klar, elegant, kräftig. Er erreicht eine wundersame Leichtigkeit, bereitet grosses Lesevergnügen. Wie in einem Spiel erschliesst sich ein Stück Weltgeschichte.
Das Ich von heute
Kopernikus, Kepler und Galilei brachten die alte Ordnung nicht nur im Weltall zum Einsturz, sondern auch auf Erden. Die moderne Entwicklung, die damals ihren Anfang nahm, hat zur heutigen Quantenphysik geführt. Diese uns verständlich zu machen, versucht Haller erst gar nicht. (Wer will, kann sich im Netz anzunähern versuchen.) Er konzentriert sich darauf, dass eine der handfesten Anwendungen der Quantenphysik, nämlich die digitale Bild- und Tonproduktion, das Individuum erzeugt, das Haller das «Shifter-Ich» nennt. Ein Shifter ist in der Semiologie, der Zeichenlehre, ein Zeichen, das seine Bedeutung erst aus dem Kontext erhält, wie z.B. «es». Gemeint ist ein Ich, das sich nach den Vorstellungen richtet, die es sich davon macht, was sein jeweiliges Gegenüber von ihm erwartet oder was die jeweilige Situation von ihm verlangt. Dafür braucht es vor allem die Fähigkeit zu situativer Anpassung und zu schnellen Reaktionen.
Neue Horizonte
Im letzten Kapitel wagt Haller einen vielleicht zu kühnen Blick in die Zukunft: wir werden in zwei Welten leben, sagt er, in der analogen und in einer virtuellen, in der es die gewohnte Realität nicht mehr gibt, sondern nur noch vereinzelte, individuelle Wahrnehmungen. Was in der Zeit und im Raum zwischen solchen Wahrnehmungen geschieht, wissen wir nicht: es ist abhängig vom Zufall. Das Ich soll eine «biologische Interpretation» sein, statt Wirklichkeit gibt es «archivierte Schichten» – hier bekennt das schreibende Ich, dass es überfordert ist und skeptisch wird. War nicht auch die Geburt des Internets begleitet vom Versprechen auf die Entstehung von etwas ganz Anderem, nie Dagewesenem? Was ist daraus geworden? Ja, doch, Neues ist entstanden. Aber gleichzeitig haben sich die alten ökonomischen und politischen Mächte mit grausamer Banalität durchgesetzt. Das Netz ist fest im Griff von Grosskonzernen und Diktaturen.
Und die Literatur?
Die Physik kann als Leitwissenschaft des 20. Jahrhunderts gelten. An ihr kommt auch die Literatur nicht vorbei. Am Beginn standen Werke, die sich mit Physiker-Biographien beschäftigten. So erzählte Max Brod 1915 in seinem Roman «Tycho Brahes Weg zu Gott» von der Begegnung der beiden Physiker Tycho Brahe und Johannes Kepler in Prag. Später, insbesondere nach dem Abwurf der ersten Atombombe, wurde der einzelne Physiker eher zum beispielhaften «Fall». Friedrich Dürrenmatts «Die Physiker» und Heinar Kipphardts Schauspiel «In der Sache J. Robert Oppenheimer» fragten in den 60er Jahren nach der Verantwortung der Wissenschaftler und ihrem Verhältnis zur Politik. Brechts Jahrhundertstück «Leben des Galilei» formulierte grundsätzlich die Hoffnungen, Möglichkeiten und Enttäuschungen, die mit dem wissenschaftlichen Fortschritt in der Moderne verbunden waren.
Zwei auf Helgoland
Auch Christian Haller nutzt in seiner Novelle «Sich lichtende Nebel» (Luchterhand 2023) eine Physiker-Biographie. Er erzählt von der historisch verbürgten Episode, wie sich der junge Physiker Werner Heisenberg 1925 wegen eines Heuschnupfens nach Helgoland zurückzog und dort unter vielfachen Geburtswehen die entscheidende Schrift zur Begründung der Quantenmechanik verfasste, «DER», wie es uns eine Helgoländer Gedenktafel verkündet, «GRUNDLEGENDEN THEORIE / DER NATURGESETZE / IM ATOMAREN BEREICH, / DIE DAS MENSCHLICHE DENKEN / WEIT ÜBER DIE PHYSIK HINAUS / TIEFGREIFEND BEEINFLUSST HAT.» Kapitelweise abwechselnd, erzählt Haller aber auch von einer zweiten Figur: dem pensionierten, verwitweten Historiker Helstedt, der, um mit dem Leben im Alter fertig zu werden, zu schreiben anfängt.
Im Dunkeln sehen wir nichts
Zwei starke Bilder bleiben nach der Lektüre der Novelle im Gedächtnis. Beide illustrieren Grundzüge der Quantenphysik. Zu Beginn der Erzählung beobachtet der junge Physiker nachts einen Passanten, der im Lichtkegel einer Laterne erscheint, dann im Dunkeln verschwindet, und im Licht der nächsten Laterne wieder auftaucht. Die grosse Frage: Was weiss der Beobachter von dem Passanten in der Zeit, während er im Dunkeln verschwunden ist? Antwort: nichts. Der Passant könnte stehen bleiben, umkehren, sterben… Auch die Physiker erhalten von den kleinsten Teilen der Materie nur lückenhafte Informationen. Sie tauchen an unvermuteten Stellen auf – und was zwischen den Momenten ihres Erscheinens geschieht, wissen wir nicht.
Was ist Materie?
In unvorstellbarer Weise sind die Physiker zur Annahme gezwungen, dass die Materie gar nicht aus festen Teilen besteht, sondern aus Energiezuständen. Heisenberg ringt in der Einsamkeit seiner Klause auf Helgoland mit dem Versuch, solche Sachverhalte zu erfassen. Helstedt, Hallers rein fiktiver zweiter Protagonist, hat zu seiner eigenen Verblüffung plötzliche Halluzinationen: er sieht die Gegenstände seiner Umgebung als leuchtende, brennende Bewegungen.
Beengend, aber vertraut
Der Literaturkritiker Paul Jandl hat in seiner NZZ-Rezension von Hallers Novelle Heisenberg zur Hauptperson der Erzählung erklärt, während er Helstedt als dessen Gegenfigur sieht, die sonderbare Visionen hat und sich selbst verliere. Hallers Hellstedt hat dem Kritiker eigentlich schon geantwortet, denn er sagt einem Freund: Du möchtest, dass die Welt so angenehm eingerichtet ist wie deine Wohnung: «gleichbleibend, mit definierten Orten für jedes Ding, vollgestellt, beengend, vertraut» (S.117). Eine freiere Lektüre könnte wahrnehmen, dass der junge Wissenschaftler und der alte Professor, einander ebenbürtig, in zwei verschiedenen Sprachen, der Sprache der Mathematik und der Sprache der Phantasie, versuchen, das unbekannte Neue einzukreisen. Helstedt bemerkt bald, dass auch er selbst Teil dieser neu entdeckten, wunderbar seltsamen Ordnung ist, und er empfindet dabei, von Haller zart angedeutet, einen unverhofften Trost. Vielleicht kann er, wenn es ans Sterben geht, in diese grössere Ordnung eintreten.
Ruhig aber packend ist Hallers Sprache. Unmodisch aber zeitgenössisch sein Thema. Individuell profiliert, aber zur Identifikation einladend sind seine Figuren. Hallers Novelle ist ein Meisterwerk.
literaturblatt.ch 4. 11. 2023
Christian Haller «Sich lichtende Nebel», Luchterhand
Gallus Frei
Zu Beginn des Jahres 1925 war der eben habilitierte Werner Heisenberg in seinen Studien zur Quantentheorie kurz vor dem Durchbruch, erst erahnend, was diese in der Wissenschaft anrichten würden. Christian Haller nimmt sich in seiner Novelle „Sich lichtende Nebel“ nicht nur genau jener Zeit an, sondern dem Gefühl damals Weniger, dass unsere Wahrnehmung alles andere als deckungsgleich mit der „Wahrheit“ sein muss.
Erstaunlich genug, dass Christian Haller sich einem physikalischen Thema mit derartiger Leichtigkeit literarisch widmen kann, dass er es schafft, einen solchen Stoff, einen solchen Moment des sich lichtenden Nebel mit der zarten Beschreibung zweier nicht unähnlichen und in ihrer Biografie so unterschiedlichen Protagonisten zu verknüpfen. Selbst wenn ich das, was Heisenberg, von Christian Haller respektvoll „Beobachter“ genannt, damals in seinem Denken entwickelte, nicht wirklich verstehe, erahne ich den Moment des „Sich Lichtens“. Nicht dass es Heisenberg damals wie Schuppen von den Augen fiel – aber die Ahnung, was sein Erkennen für Konsequenzen auslösen würde, muss als Gefühl erschütternd gewesen sein.
Christian Haller verwebt die Geschehnisse um den jungen Physiker Heisenberg mit den schwierigen Tagen eines emeritierten Historikers. Helstedt hat sich nach dem Tod seiner Frau zurückgezogen, auch wenn er sich ab und an mit seinem Kollegen Sörensen trifft und in der Suche nach Erkenntnis, reichlich unterstützt durch Wein, Austausch sucht. Eine Suche, die ihm neben seinem Schmerz mehr und mehr die Gewissheit gibt, dass mit dem Nichtmehrdasein nicht zwingend eine Liebe zu Ende sein muss. Heisenberg und Helstedt erahnen, dass es neben der offensichtlichen „Wirklichkeit“ Ebenen geben muss, die sich unserer (meiner) Vorstellung entziehen.
«Seine Schrift auf der weissen Heftseite war wie die Spur im Schnee, die ein Fuchs gezogen hatte.»
Beide, Heisenberg und Helstedt, wagen einen Aufbruch. Heisenberg aus den Fesseln eines vorgegebenen Denkens, Helstedt aus seiner inneren Isolation. „Es kann nur existieren, wofür es Wörter, eine Sprache gibt.» Eine Novelle darüber, wie eine Banalität einer weltbewegenden Idee die Initialzündung gibt. Christian Haller lässt Figuren auftreten, deren Biographien sich durch Handlungen und Ideen ineinander verschränken. Nach zwei Trilogien, die sich mit Hallers eigner Herkunft, seinem Leben auseinandersetzen, sei der Stoff um Heisenberg und seine Quantenphysik wie eine neue, noch unbesetzte Keimzelle, die zum Buch wurde, erklärte Christian Haller an einem Auftritt an den Solothurner Literaturtagen 2023. Eine Novelle, die viel mehr will als das Verbildlichen einer komplexen physikalischen Fragestellung. «Sich lichtende Nebel» ist eine Liebesgeschichte, nicht zuletzt eine zur Liebe des Sehens, des Erkennens.
So schmal das Buch ist, so erkenntnisreich die Ahnungen, die es provozieren kann. „Sich lichtende Nebel“ ist ein starkes Stück Literatur! Ich spüre seine grosse Faszination, die die Sprache selbst für den Autor bedeutet, die Weite an Erkenntnis, die sich offenbart.
Christian Haller hätte es sich leichter machen können. Aber die Tiefen von Einsicht und Erkenntnis sind nicht hell ausgeleuchtet. Nur wer sich darum bemüht, dem lichten sich die Nebel.
Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. 2006 mit dem Aargauer Literaturpreis, ein Jahr später mit dem Schillerpreis und 2015 mit dem Kunstpreis des Kantons Aargau ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen denStrom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg.
Schweizer Buchhandel
Die hohe Schule des Augenblicks
«Sich lichtende Nebel» von Christian Haller (80) wurde in vielen Rezensionen als Meisterwerk bezeichnet. Die Nominierung zum Schweizer Buchpreis rückt die Novelle jetzt noch ein Stück mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Ein Glück.
Von Pascale Blatter
Elegant! So lässt sich der Schreibstil des Buchs «Sich lichtende Nebel» von Christian Haller am besten beschreiben. Und eine elegante Erscheinung ist Christian Haller selbst, als er die Tür seines Altstadthauses in Laufenburg öffnet. Zudem ist er so freundlich und zuvorkommend, dass man die Scheu vor seiner grossen Bekanntheit gleich vergisst. Er geht über eine schmale Treppe in den zweiten Stock voraus. Hier befindet sich eine gemütlich eingerichtete Bibliothek, an die sich eine Veranda mit grossen weissen Holzfenstern anschliesst. Auf einem Tischchen steht eine Karaffe Wasser und zwei Gläser bereit. Von diesem Platz aus sieht man den Rhein grün und golden schimmernd vorbeiziehen – die Aussenmauer des alten Hauses ragt direkt aus dem mächtigen Fluss. Mit diesem Ausblick hatte man beim Eingang von der Stadtseite her nicht gerechnet.
Ein Moment der Wende
Von plötzlichen Einsichten handelt auch die Novelle «Sich lichtende Nebel». Das schmale Buch erschien dieses Jahr bei Luchterhand und geht bereits in die 5. Auflage. Christian Haller wurde 1943 in Brugg geboren und verbrachte sein ganzes Erwachsenenleben als Schriftsteller in der Schweiz. Mit 19 Jahren entschied er sich, Schriftsteller zu werden. «Es gab ein Initiationserlebnis» erzählt er. «Während eines Spaziergangs durch einen Hain von Kastanienbäumen kamen Wörter zu mir, die ein Gedich werden wollten. In dem Moment wusste ich, dass Schreiben mein Weg sein würde.» Das seien Augenblicke, wo die gewohnte Sicht aufbricht und wo man seinem Leben eine Wendung geben könne – die für immer vorbei seien, wenn man sie nicht ergreife.
Biologie studiert
Nach Jahren des Schreibens begann Christian Haller ein Biologiestudium an der Universität Basel. Das Leben aus wissenschaftlicher Sicht zu studieren, schien ihm eine notwendige Basis, um als Autor zu arbeiten. Nach sechs Jahren Studium schloss er mit Summa Cum Laude ab. Das Angebot eines Forschungslabors in Basel lehnte er ab, und er blieb bei seinem Entschluss, Autor zu sein. Der Versuchung, zum Broterwerb nebenher als Lehrer zu arbeiten, widerstand er ebenfalls: «Didaktik verdirbt den Stil. Das war meine damalige, jugendliche Befürchtung.»
Ein Universal-Gelehrter
Christian Haller ist als Schriftsteller ein Universal-Gelehrter. Er beschäftigte sich mit Geschichte, Kosmologie, Mystik, Chemie. Die letzten 15 Jahre befasste er sich auch mit Physik, «soweit mir das zugänglich und möglich ist». Dabei stiess er auf die Anekdote, die das Grundmotiv von «Sich lichtende Nebel» bildet. 1925 beobachtete der junge Physiker Werner Heisenberg nachts einen Mann, der im Lichtkegel einer Strassenlaterne auftauchte, im Dunkel verschwand, um im Licht der nächsten Laterne erneut aufzutauchen. Diese Beobachtung inspirierte Heisenberg zur Entwicklung der Quantenmechanik. «Mich faszinierte, dass eine alltägliche Beobachtung zu einer die Weltsicht verändernden Entdeckung führt», sagt Christian Haller. «Und ich fragte mich: Wer war der Unbekannte und ist durch die unbewusste Berührung auch er zu neuen Einsichten gekommen?»
Alles bezieht sich aufeinander
Der Autor Christian Haller entwickelte den Spaziergänger als pensionierten Geschichtsprofessor, der nach dem Tod seiner Frau allein lebt und ein merkwürdiges Erlebnis hat: Er sieht für einen Augenblick durch die Erscheinungen der Welt hindurch und erkennt die Materie als bläulich strahlende, durchsichtiger Energieteile, die sich alle aufeinander beziehen. Der Geschichtsprofessor kauft sich ein liniertes Heft und versucht, die Wahrnehmung in Worte zu fassen – daraus entsteht ein weiterer Strang der Geschichte, das Nachdenken übers Schreiben. Und eine Liebes- und Freundschaftsgeschichte findet auch ihren Platz. Christian Haller verschränkt die verschiedenen Motive wie in einer Kunst der Fuge, wo sich alles aufeinander bezieht, auflöst und verstärkt. Was komplex tönt, erscheint in diesem Text maximal leicht.
Luzider Text
Wie ist es möglich, so luzide, schön und schwindelerregend einfach zu schreiben? Im Lauf des Gesprächs gibt es verschiedene Antworten. Fürs Lektorat seiner Bücher rechne er ein ganzes Jahr ein, sagt Christian Haller einmal. Sein Lektor bei Luchterhand ist seit Jahrzehnten derselbe, «ein altgedienter und hervorragender Lektor» – er arbeitet auch nach dessen Pensionierung mit ihm weiter. Und ein andermal sagt Christian Haller: «Wie die meisten von uns Autorinnen und Autoren habe ich mit Lyrik begonnen. Danach arbeitete ich fünf Jahre lang an einem Märchenband. Bei den Volksmärchen lernte ich erzähltechnisch enorm viel: Sie haben eine moderne Erzählstruktur, mit grossen Sprüngen und repetitiven Elementen.» Die Novelle «Sich lichtende Nebel» nimmt am Schluss auch noch einmal eine überraschende Wendung – der Spannungsbogen hält bis zum letzten Satz.
hristian Haller erhält den Schweizer Buchpreis 2023 für seine jüngste Novelle. Der Preis würdigt auf diesem Weg auch sein Gesamtwerk
Die Novelle «Sich lichtende Nebel» ist das Buch der Stunde. Es ist eine poetische Studie zur Ungewissheit. Zu Recht erhält Christian Haller dafür den Schweizer Buchpreis.
NZZ, 19. 11. 2023
Christian Haller, Gewinner des Schweizer Buchpreises 2023.
von Roman Bucheli
Nicht immer hat die Zeit auch die Bücher, die sie braucht. Mit Christian Hallers Novelle «Sich lichtende Nebel» hat sich der Glücksfall ergeben, dass dieses Buch gerade nicht einlöst, was sein Titel verspricht. Nichts lichtet sich in der Novelle, sie stellt vielmehr eine beharrliche Einübung in die Unschärfe aller Verhältnisse und in die Verunsicherung des Daseins dar. Was aber wäre in Zeiten andauernder Krisen, wie wir sie erleben, dringlicher als gerade eine solche leichthändige Betrachtung über den Verlust vieler Gewissheiten?
So ist es denn eine schöne Fügung, dass die Jury des Schweizer Buchpreises am Sonntag entschieden hat, Christian Haller für seine Novelle auszuzeichnen. In ihrer Begründung schreibt sie: «Meisterhaft verdichtet Christian Haller komplexe Themen zu einer Novelle, die einfach und leicht verständlich daherkommt und dabei durch gedanklichen Tiefgang ebenso überzeugt wie durch sprachliche Eleganz und Klarheit.» Der Preis ist mit 30 000 Franken dotiert.
Mystische Erleuchtung
In seiner schmalen Novelle bringt Christian Haller, der im vergangenen Februar achtzig Jahre alt geworden ist und ein grosses literarisches Œuvre geschaffen hat, zwei höchst unterschiedliche Figuren 1925 in Kopenhagen zusammen. Da ist einerseits der pensionierte und verwitwete Geschichtsprofessor Helstedt, der grübelnd und zweifelnd (wenn nicht verzweifelt) durch die nächtliche und nur spärlich von Strassenlaternen beleuchtete Stadt geht. Beobachtet wird er von einer historisch verbürgten Figur.
Der junge Physiker Werner Heisenberg ist in der Stadt und trifft sich hier mit seinem dänischen Kollegen Niels Bohr. Ihre Gespräche drehen sich um ihre revolutionären Forschungen, mit denen sie Licht in die innersten Geheimnisse der Physik bringen wollen. Auf Helgoland, wohin sich Heisenberg wegen eines Heuschnupfens zurückzieht, erlebt er eine Art mystische Erleuchtung. Es lichten sich die Nebel, er formuliert die Grundlagen der Quantenmechanik.
Gegenläufig ist dagegen die Erfahrung des nächtlichen Spaziergängers. Wo Heisenberg in der Unschärfe den Kern seiner Theorie erkennt, verliert sich Helstedt zunehmend in den Ungewissheiten seiner Wahrnehmungen und Denkwege. Auch er macht eine mystische Erfahrung. Es ist ihm, als sehe er ins Innere der Materie, nur dass ihm die Sprache fehlt, seine Wahrnehmungen angemessen darzustellen. Er wird selber Teil dessen, was er beobachtet, die Unschärfe greift auf ihn über.
Prekäre Erinnerungen
Es ist nun allerdings auch eine elegante Fügung, dass Christian Haller den Buchpreis ausgerechnet für eine Novelle erhält, die den Glutkern seiner Poetik zu ihrem Thema macht. Denn damit wird nun gleichzeitig ein Gesamtwerk gewürdigt, das die Erkenntniskritik stets zu seinem innersten Anliegen erklärt hat. Angefangen mit der zwischen 2001 und 2006 erschienenen «Trilogie des Erinnerns», mit der Haller die eigene Familiengeschichte erforscht hat, bis zu seiner 2020 mit dem Band «Flussabwärts gegen den Strom» abgeschlossenen autobiografischen Trilogie steht dieses Werk konstant im Zeichen einer prekären Selbstvergewisserung.
Der Autor dieser selbst- und familienbiografischen Werke macht dabei durchaus die gleiche Erfahrung wie der nächtliche Spaziergänger Helstedt. Die Gewissheiten verlieren sich im Augenblick, da der Erzähler ihrer habhaft werden möchte. Im Gegensatz zum grüblerischen Geschichtsprofessor steht Christian Haller mit der poetischen Sprache indessen ein Erkenntnisinstrument zur Verfügung, das Erinnerungen nicht dingfest, aber immerhin in ihrer Brüchigkeit darstellbar macht. Die Novelle ist eine Quintessenz dieses Schaffens. Sehr zu Recht ist sie darum mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet worden.